Die Sonne war der ganze Himmel
Der 21-jährige John Bartle und der 18-jährige Daniel Murphy gehören dem Truppenkontingent an, das die Vereinigten Staaten in den Irak geschickt haben. Die beiden sind zwei sich miteinander anfreundende Kleinstadtjungs, noch ein wenig grün hinter den Ohren, mehr Flaum als Bartwuchs auf den Wangen und Hin- und Hergeworfen zwischen ihren Ängsten und Erwartungen. Unvorbereitet trifft sie die Realität des Krieges mit seinem ganzen Schrecken, einer Wucht, der John und Daniel nicht standhalten können. Powers, der selbst als Soldat im Irak stationiert gewesen ist und nach seiner Entlassung Literatur studierte, zeichnet ein so nüchternes wie schonungsloses Bild: Dem Krieg „war es egal, ob man geliebt wurde oder nicht." Heldentum und Solidarität schmelzen in der Wüstensonne, die Grenzen zwischen Gut und Böse lösen sich auf. Aus der Ich-Perspektive von John Bartle, dem es nicht gelingt, das Erlebte nach seiner Rückkehr zu verarbeiten, blättert Powers in insgesamt elf Kapiteln, die zwischen 2003 und 2009 spielen, die Geschehnisse auf, die sich bis zu Daniels Tod ereigneten. Bartie, der zwar froh ist, mit heiler Haut davongekommen zu sein, ist desillusioniert und verwahrlost zunehmend. Der Krieg hat ihn seiner Unschuld beraubt. Mit „Die Sonne war der ganze Himmel“ hat Powers das Genre der Kriegsliteratur neu belebt. Jeder Krieg tötet, leider sind es nicht nur die Hoffnungen und Ideale, die zerstört werden. Sein Debütroman ist ein starkes Stück Literatur, genährt von der Realität in all ihrer Grausamkeit. Ralf Nestmeyer Kevin Powers: Die Sonne war der ganze Himmel, S. Fischer Verlag, Frankfurt 2013, 240 S., 19,99 Euro |
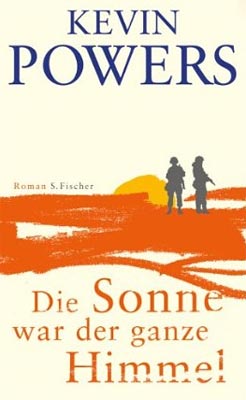 Wer geglaubt hat, das Genre der Kriegsliteratur habe sich spätestens seit Ernst Jünger, Erich Maria Remarque und Ernest Hemingway erschöpft, wird von Kevin Powers Roman „Die Sonne war der ganze Himmel“ eines Besseren belehrt. Ohne sich in Schilderungen von Gewaltexzessen zu verlieren, schildert Powers mit einer eindringlichen Intensität das Schicksal zweier junger Amerikaner, die als Soldaten im Irak nicht nur moralisch, sondern auch psychisch an ihre Grenzen getrieben werden.
Wer geglaubt hat, das Genre der Kriegsliteratur habe sich spätestens seit Ernst Jünger, Erich Maria Remarque und Ernest Hemingway erschöpft, wird von Kevin Powers Roman „Die Sonne war der ganze Himmel“ eines Besseren belehrt. Ohne sich in Schilderungen von Gewaltexzessen zu verlieren, schildert Powers mit einer eindringlichen Intensität das Schicksal zweier junger Amerikaner, die als Soldaten im Irak nicht nur moralisch, sondern auch psychisch an ihre Grenzen getrieben werden.